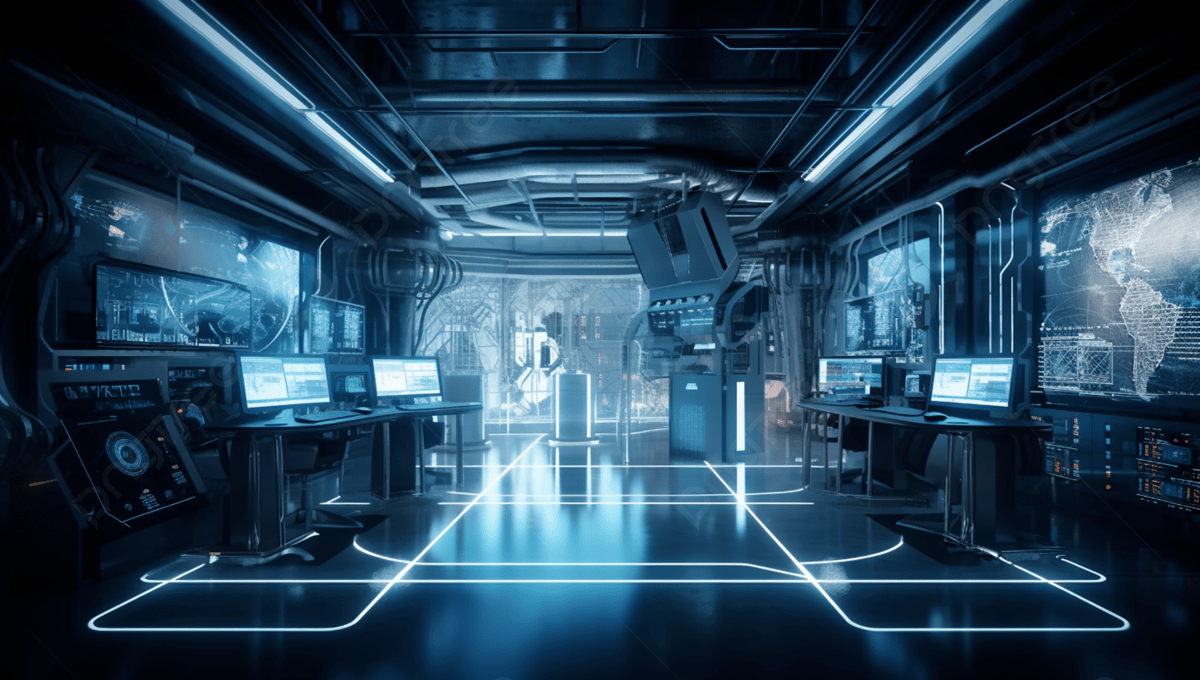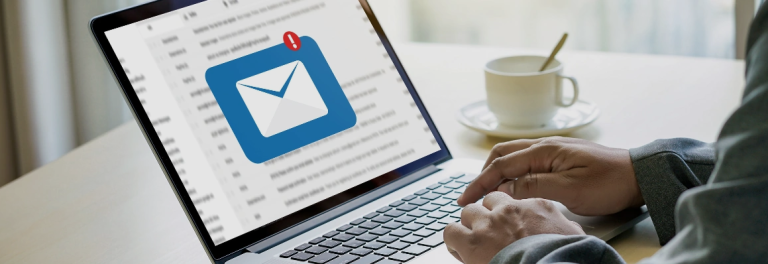VON DER GESCHLOSSENEN HARDWARE ZUR DIGITALEN FREIHEIT
Eigentlich wäre auch einmal interessant zu betrachten, wie wir heute in der tagtäglichen IT den aktuellen Status erreicht haben. Nahe zu Jeder und Jede haben ein Handy/Smartphone, Social Media sind allgegenwärtig. Jeder gekaufte PC, Mac oder Laptop hat eines von zwei marktdominierenden Betriebsystemen – je nach Geschmack. Das war aber nicht immer so.
Wie war die Hardware- und Softwaresituation vor der Free Software Foundation?
In den Anfangsjahrzehnten der Computertechnik – etwa von den 1940ern bis in die 1970er – war die Welt der Computertechnik stark zentralisiert. Großrechner dominierten den Markt, gebaut von wenigen großen Herstellern wie IBM, UNIVAC oder DEC. Diese Hardware war teuer, schwer zugänglich und meist an ganz bestimmte Softwarelösungen gebunden.
Interessanterweise wurde Software zu dieser Zeit oft kostenlos mitgeliefert, allerdings ohne klare Nutzungsrechte oder Zugang zum Quellcode. Der Begriff „frei“ im Sinne der späteren Free Software war damals nicht gebräuchlich. Auch wenn Quelltexte manchmal offen lagen, war dies eher eine pragmatische als eine ideologische Entscheidung.
Mit dem Aufkommen von Mikrocomputern in den 1970er-Jahren – etwa durch Apple oder den IBM PC – begann eine Wende: Software und Hardware wurden zunehmend zu kommerziellen Produkten. Hersteller begannen, Schnittstellen zu schließen, Software durch Lizenzen zu schützen und Systeme technisch wie rechtlich zu verriegeln.
Die Gründung der Free Software Foundation (FSF) im Jahr 1985 durch Richard Stallman war eine Reaktion auf diese Entwicklung. Ihr Ziel war es, den Nutzern ihre Freiheit zurückzugeben: Software sollte nicht nur kostenlos, sondern vor allem frei im Sinne von „freiheitlich“ sein – also offen, veränderbar und teilbar.
War geschlossene Hardware schon vor der FSF ein Thema?
Ja – und das ist ein entscheidender Punkt. Die Vorstellung, dass früher alles offen und kollaborativ war, ist romantisiert. Bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren war Hardware vielfach proprietär. Hersteller dokumentierten zwar vieles, aber erlaubten nicht zwangsläufig freie Nutzung oder Modifikation.
Das Prinzip der „Black Box“ – also Systeme, deren Innenleben und Funktionsweise für den Nutzer nicht zugänglich oder verständlich ist – existierte schon früh. Der Unterschied zu späteren Jahrzehnten liegt vor allem in der zunehmenden rechtlichen Absicherung dieser Abschottung (z. B. durch Urheberrechte, Patente oder Lizenzen) sowie in der bewussten Erzeugung von Abhängigkeiten.
Warum sind Apple und Microsoft trotz freier Alternativen wie Linux immer noch erfolgreich?
Heute steht mit Linux und vielen Open-Source-Projekten eine starke, funktionale Alternative zu kommerziellen Systemen bereit. Dennoch dominieren Microsoft (Windows) und Apple (macOS) weiterhin den Massenmarkt. Warum?
- Netzwerkeffekte und historische Dominanz:
Microsofts Windows war lange Zeit alternativlos in Schulen, Unternehmen und Behörden. Das hat ganze Generationen geprägt – inklusive Softwarelandschaften und Arbeitsabläufe. - Komfort und Ökosystembindung:
Apple bietet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ökosystem aus Hard- und Software. Viele Nutzer bevorzugen ein funktionierendes Gesamtsystem – auch wenn es teuer oder eingeschränkt ist. - Bequemlichkeit schlägt Freiheit:
Linux ist mächtig und frei – aber auch komplexer. Viele Menschen wollen sich nicht mit Technik auseinandersetzen, sondern einfach ein Gerät, das funktioniert. - Marktmacht durch Distribution:
Windows ist auf fast allen neuen PCs vorinstalliert. Apple kontrolliert den gesamten Hardware-Software-Stack. Beide schaffen so wirtschaftliche Abhängigkeiten. - Spezialisierte Software:
Viele Profi-Anwendungen (z. B. Adobe, AutoCAD, Microsoft Office) sind entweder gar nicht oder nur eingeschränkt unter Linux nutzbar.
Sind wir wieder da, wo wir in den 1970ern waren?
In vieler Hinsicht: Ja. Heute wie damals sind viele Systeme geschlossen, zentralisiert und kontrolliert durch große Konzerne. Nutzerfreiheit, Interoperabilität und Reparierbarkeit sind erneut eingeschränkt.
| 1970er Jahre | Heute |
| IBM dominiert Großrechnermarkt | Microsoft und Apple dominieren Endgeräte |
| Software nur vom Hersteller | Apps nur über App Stores |
| Wartung nur durch lizenzierte Techniker | Reparatur erschwert, oft gesetzlich eingeschränkt |
| Wenig Kontrolle durch Nutzer | Nutzerrechte oft stark beschnitten (DRM, Cloud-Zwang, Abo-Modelle) |
Allerdings ist heute auch vieles anders:
- Open Source ist global etabliert:
Linux läuft auf Servern, Smartphones (Android), Supercomputern – es ist kein Nischenprodukt mehr. - Es gibt Alternativen:
Projekte wie LineageOS, Nextcloud oder Mastodon zeigen, dass freie Software heute ernsthafte Alternativen darstellen kann. - Rechtsbewegungen entstehen:
Die „Right to Repair“-Bewegung, Datenschutzinitiativen und freie Lizenzmodelle sind Ausdruck eines gesellschaftlichen Bewusstseinswandels.
Fazit
Wir leben in einer paradoxen Zeit:
Einerseits gibt es mehr freie Software, mehr Wissen, mehr Möglichkeiten zur Selbstermächtigung als je zuvor.
Andererseits kontrollieren große Technologiekonzerne unsere digitale Infrastruktur in einem Ausmaß, das fast schon wieder an die monopolistischen Strukturen der 1970er erinnert.
Der Unterschied ist:
Heute können wir uns bewusst dagegen entscheiden. Die Werkzeuge sind da – wir müssen sie nur nutzen.